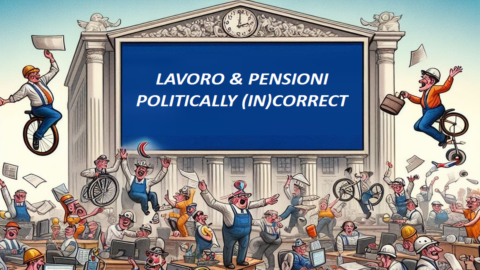Der ausführliche Text von Alessandro Pansa auf FIRSTonline vom 14. Januar verdient einen ausführlichen Kommentar. Einige Punkte der Argumentation scheinen unwiderlegbar:
1) Insbesondere bei den Kapitalquoten der Banken besteht die Gefahr einer Überregulierung. Um die nächste Bankenkrise zu verhindern, wird die aktuelle Krise verlängert, wodurch es für Banken schwieriger wird, Kredite an Unternehmen zu vergeben.
2) Das internationale Bankensystem ist zu konzentriert und einige sehr große Intermediäre haben zu viel Macht. Das ist ein Ergebnis der Krise, schon gar nicht der Liberalisierung der vorangegangenen Jahrzehnte, denn fast alle Bankenkrisen wurden durch Fusionen gelöst. Es ist jetzt nicht einfach, zurückzukehren, aber es sollte nicht unmöglich sein.
Zu vielen anderen, grundlegenderen Fragen ist die Diskussion offen.
1. Es darf bezweifelt werden, dass die seit den 80er Jahren einsetzenden Liberalisierungsprozesse das Ergebnis der Lobby der Finanzindustrie sind. Im Gegenteil wurden sie, wie alle Liberalisierungsprozesse, von Regierungen mit dem Ziel einer Steigerung des Wettbewerbs umgesetzt und erfolgten in der Regel gegen den Willen der betroffenen Subjekte. Die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes durch die Clinton-Regierung erfolgte, um den Investmentbanken das Investmentbanking-Monopol zu entziehen. Die Beschränkungen des zwischenstaatlichen Bankwesens wurden aufgehoben, weil sie eine anachronistische Verteidigung der Bankmiete darstellten.
In Europa beseitigte die Zweite Bankenrichtlinie die Barrieren, die die Banken in jedem Land vor der Konkurrenz durch andere europäische Banken schützten. Italienische Banker waren, wie auch die vieler anderer Länder, überhaupt nicht zufrieden mit einer Innovation, die einen qualitativen Sprung in der Wettbewerbsintensität auf dem gesamten Kontinent bewirkte. Hier legte diese Richtlinie den Grundstein für die Abschaffung des merkwürdigen und nicht mehr nachhaltigen Privilegs der Mediobanca, der einzigen Bank, die jahrzehntelang erlaubt war, Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben.
2. Als ehemaliger Beamter der Bank von Italien möchte ich feststellen, dass es nicht wahr ist, dass „die Lektion (von der Instabilität eines unregulierten Systems) nicht auswendig gelernt wurde“. Diese Lektion war sehr klar und tatsächlich wurde weder in Italien noch anderswo daran gedacht, die Sonderregulierung für den Bankensektor abzuschaffen. Seit den XNUMXer Jahren gehen Finanzen und Finanzkontrolle Hand in Hand. Seit den XNUMXer Jahren wird versucht, das Kontrollsystem mit dem Wettbewerb zu verbinden. Dies war die Mission, der sich Gouverneur Ciampi mit echter bürgerlicher Leidenschaft widmete (fernab von Finanzlobbys!) und die inmitten von Höhen und Tiefen die Zustimmung von Regierungen und Parlamenten fand.
Wenn man darüber hinaus daran zurückdenkt, wie das Bankensystem in den frühen Achtzigern aussah, ist es sehr schwer, Nostalgie für das zu empfinden, was später als „versteinerter Wald“ bezeichnet wurde, also ein System, in dem es ein Verbot für die Gründung neuer Banken gab, in dem es Konkurrenz gab Gemäß dem Filialplan der Bank von Italien wurde die Kreditvergabe durch Instrumente wie die Obergrenze für Kredite, die Portfoliobeschränkung, die Bestimmungen zum Thema PNE der Banken sowie durch die Kontrolle der Ströme reguliert privaten Kapitals ins und aus dem Ausland.
Es ist auch schwer, das System des ICS und der doppelten Intermediation zu bereuen, bei dem sich der Geschäftsbanker, der das Unternehmen kannte, und das mittelfristige Institut, das die Projekte kannte, normalerweise nicht trafen. Alles in allem war dies ein teures und dysfunktionales System, das den Banken ein friedliches Leben sicherte, aber es war absolut nicht zu rechtfertigen.
3. Es mag verlockend klingen, aber die Vorstellung, dass die Finanzmärkte instabil sind und „auch die Marktwirtschaften, die von dem darauf aufgebauten Finanzüberbau dominiert werden, instabil gemacht haben“, wird durch die Fakten nicht gestützt. Charles Kindelberger dokumentierte die vielen Krisen, die es gab, lange bevor es Finanzmärkte gab: den Ansturm auf Gold und andere Edelmetalle oder Tulpen im Holland des 17. Jahrhunderts, gefolgt von Krisen. Die Krise von 1929 selbst hatte in ihrer Anfangsphase wenig mit dem Finanzwesen zu tun: Die Anleger glaubten an die Industrie – nicht an das Finanzwesen – und kauften deren Aktien, bis ihr Wert auf ein Niveau stieg, das nichts mit den Fundamentaldaten zu tun hatte.
Schon lange vor den Liberalisierungen in den 1982er Jahren kam es zu sehr schweren Finanzkrisen. Wir erinnern uns an die Krisen des Goldstandards (die zu seiner Aufgabe führten), an die Krise des Bretton-Woods-Systems (das ebenfalls aufgegeben wurde), an die vielen Krisen in den Ländern Lateinamerikas, beginnend mit der sehr schweren Krise in Mexiko im Jahr XNUMX , die Spar- und Kreditkrise in den USA usw. Dies bedeutet nicht – und das sei wiederholt –, dass die Finanzmärkte reguliert werden müssen. Die Vorstellung, dass dies vor der Krise nicht der Fall war, ist eine polemische Marionette. Andererseits hat die Krise eklatante Lücken in der Regulierung offengelegt, etwa im Hinblick auf das „Originate and Distribute“-Modell von Subprime-Hypotheken.
4. Niemand hat jemals gedacht (nicht einmal Friedman oder seine Anhänger), dass es Sinn macht, die Logik der Märkte der der Demokratie gegenüberzustellen. Politische Entscheidungen müssen von Regierungen getroffen werden. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Niemand hielt es jemals für wünschenswert, Machtanteile von den Regierungen auf die Finanzmärkte zu verlagern. Es gibt keine „Globalisierungsorthodoxie“, die einen solchen Prozess für wünschenswert hält.
Es gibt auch keine Wirtschaftstheorie, die davon ausgeht, dass Finanzmärkte dazu führen, „soziale Ungleichgewichte wieder aufzufangen“. Wie jeder weiß, besagt die orthodoxeste Theorie, dass Märkte zu einer effizienten Allokation von Ressourcen führen, aber sicherlich nicht zu einer fairen Allokation. Wenn auf jeden Fall jemand denkt, dass die Existenz mehr oder weniger effizienter Märkte uns von ethischen Urteilen befreien kann, irrt er in Bezug auf den gesunden Menschenverstand, aber auch in Bezug auf die eher orthodoxe Wirtschaftstheorie, völlig daneben.
5. Angesichts einer sorgfältigen historischen Analyse ist es sehr schwierig, der mittlerweile fast alltäglichen Behauptung zuzustimmen, dass die Entwicklung der Finanzmärkte die Macht der Regierungen verringert habe und daher im Widerspruch zur Demokratie stünde. Der Punkt ist, dass Regierungen schon immer vom Verhalten der Sparer beeinflusst wurden, an die sie sich wenden, um ihre eigenen Schulden oder die der Nation zu finanzieren.
In der „wunderbaren“ Welt von Bretton Woods, nach der sich viele zu sehnen scheinen, gab es Kapitalkontrollen, doch das Pfund musste mehrmals abwerten und die britischen Regierungen mussten erklären, warum immer wieder neue Opfer nötig waren. In Italien konnten all die massiven Gebäude, die in den siebziger Jahren zur Verteidigung der Lira und der italienischen Banken errichtet wurden, Kapitalabflüsse nicht verhindern, auch wenn diese ungestüm waren, wie etwa der, der die italienischen Behörden im Januar 1976 zwang, den Devisenmarkt zu schließen. Kapitalabflüsse sie Dies geschah durch Verzögerungen bei der Zahlung von Handelsströmen, Unter- und Überfakturierung und illegale Vorgänge.
Der Punkt ist, dass Sparer selbst im goldenen Zeitalter der Kapitalkontrollen, lange vor jeder Liberalisierung, als die Finanzmärkte noch sehr klein und die Banken überreguliert waren, Möglichkeiten fanden, ihr Geld sicher anzulegen, wenn sie Regierungen für nicht vertrauenswürdig hielten. So sehr, dass die italienischen Regierungen fast zehn Jahre lang unter dem Albtraum von Guido Carlis berühmter Absichtserklärung mit dem Internationalen Währungsfonds litten.
Ähnliche Ereignisse gab es in allen großen Ländern: Denken Sie daran, wie sich Mitterands Politik Anfang der achtziger Jahre aufgrund der Reaktionen der Märkte änderte. Selbst ein Land wie die Vereinigten Staaten konnte die Entwicklung eines riesigen europäischen Dollarmarktes nicht verhindern, dessen einziger Zweck darin bestand, die Umgehung der Mindestreservepflicht für in den Vereinigten Staaten ansässige Banken zu ermöglichen.
6. Die Erfahrung scheint keine Stütze für eine andere Behauptung zu sein, die inzwischen allgemein geworden ist, nämlich dass die Finanzen die Ungleichheiten zwischen Ländern vergrößern, „aufgrund der Tendenz, von weniger soliden Ländern eine strenge Politik zu verlangen, die oft rezessiv wird“. Der offensichtlichste Fall ist hier Griechenland. Seit Ausbruch der Krise im Jahr 2010 haben internationale Institutionen (also Steuerzahler aus anderen Ländern) die Märkte ersetzt. Seitdem hat Griechenland keinen einzigen Euro mehr auf den Markt gebracht, weil kein Privatmann daran dachte, ein so großes Risiko eingehen zu können.
Somit wurden alle neuen Bedürfnisse Griechenlands und die gesamte Erneuerung fälliger Schulden vom internationalen Steuerzahler finanziert. Es lässt sich kaum argumentieren, dass Griechenland seit 2010 weniger strenge Auflagen auferlegt wurden. Im Gegenteil, die Regierungen (alle, die deutsche, aber auch die französische und die italienische) haben aus Angst vor negativen Reaktionen der nationalen öffentlichen Meinung mit erheblicher Härte vorgegangen. Es ist daher keineswegs selbstverständlich, dass Märkte anspruchsvoller sind als Staaten. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Gegenteil der Fall.
7. Schließlich ist es schwer zu verstehen, warum die Tatsache, dass „die finanzielle Globalisierung dazu geführt hat, dass das Verhältnis zwischen den Ersparnissen eines Landes und der Finanzierung seines Produktionssystems verschwunden ist“, ein Problem darstellt. Für die Unternehmenswelt ist das eine Befreiung! Unternehmen sind nicht mehr gezwungen, Kredite bei lokalen Banken aufzunehmen, sondern können sich an Investoren überall auf der Welt wenden. So werden die guten Finanzsalons, in denen eine kleine Elite der üblichen Verdächtigen verteidigt wird, übersprungen. Endlich hat der fähige Unternehmer noch eine Chance, denn er kann seinen Weg auch ohne Beziehungssystem gehen.
Und endlich hört die Politik auf, gute und schlechte Zeiten in den Banken und damit in den Unternehmen zu machen: Wie können wir die Parteien vergessen, die die Sitze in den Banken aufgeteilt haben und den Gouverneur vor der Tür stehen lassen? Im Nachhinein bezeichnen die Briten das als Vetternwirtschaftskapitalismus, ein System, in dem Erfolg nicht auf Verdienst, sondern auf Beziehungen, Gefälligkeiten und Privilegien beruht. Aus all dem versuchten wir uns in den neunziger Jahren zu befreien. Wir haben nicht die Absicht, hierauf noch einmal zurückzukommen. Auch dies ist eine Lektion, die es verdient, in Erinnerung zu bleiben.